EINLEITUNG
Überblick über die Reformation in Deutschland und in der Schweiz
Die Schweiz am Vorabend der Gegenreformation
Das Werk der Gegenreformation
A- Die
Wiederherstellung des Ansehens der kartholischen Kirche
a) Die Bündnisse
b) Das Trienter
Konzil
c) Die Gründung
des Jesuitenordens
B- Die Gegenreformation in Basel, Appenzell, Glarus und den zugewanderten
Orten Graubünden und Wallis
a) Basel
b) Appenzell
c) Glarus
d) Graubünden.
e) Das Wallis
Schlussbemerkungen
Überblick über die Reformation in Deutschland und in der
Schweiz
Um
1500 bestimmten die Lehren und Vorschriften der Kirche das ganze Leben. Im
Volk herrschte aber noch viel Unwissenheit und Aberglaube : viele Menschen
glaubten, sie könnten sich durch Geld von ihren Sünden loskaufen. Aus
diesem Grund war der Kauf von Ablassbriefen besonders beliebt. In vielen
Klöstern wurde sehr wenig auf Zucht und Ordnung gehalten und die Päpste
verschwendeten die kirchlichen Einnahmen für den Bau der neuen
Peterskirche in Rom und den Prunk des päpstlichen Hofes.
|

Luther |
In
Deutschland wollte Luther das religiöse Leben reformieren und lehnte sich
gegen das Ablasswesen und gegen die Autorität der Kirche auf. Seine
Ansichten bedeuteten bald den Bruch mit der katholischen Kirche, denn im
Mittelpunkt seiner Lehre steht der Glaube, der es dem Menschen ermöglicht,
allein, das heibt, ohne Vermittlung der Kirche, den Weg zu Gott zu finden.
Die auf Erden vollbrachten Werke haben keinen Wert. Luther behauptet
sogar, dass Papst und Konzilien sich irren können.
|

Zwingli |
|
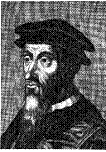 Calvin Calvin
|
In der
Schweiz folgte der Züricher Stadtpfarrer Ulrich Zwingli dem Beispiel
Luthers und machte sich daran, das kirchliche Leben zu erneuern. Er
forderte den Rat der Stadt Zürich dazu auf, die Messe abzuschaffen, die
Heirat der geistlichen zu erlauben und die oberste kirchliche Behörde zu
bilden. 1536 kam der aus Frankreich geflohene Jean Calvin nach Genf, das
er zum Zentrum seiner reformatorischen Tätigkeit machte.
Die Schweiz am Vorabend der Gegenreformation
Die
Eidgenossenschaft war konfessionell gespalten.
1531
unterlagen in der Schlacht bei Kappeln Zürich, Bern und ihre Verbündeten
dem Heer der katholischen Eidgenossen. Der nach dem Krieg unterzeichnete
Zweite Kappeler Landfriede verhinderte, dab die Reformation sich über die
ganze Schweiz ausbreitete und bestimmte von nun an die politischen und
konfessionellen Machtverhältnisse. Beide Lager durften bei ihrem Glauben
verharren. Zürich und Bern verharrten also bei dem neuen Glauben, während
die fünf inneren Orte katholisch blieben. In den Gemeinen Herrschaften
durften reformierte Gemeinden ihren Glauben behalten.
Die
Eidgenossenschaft bestand aus :
·
vier reformierten Orten : Zürich, Bern, Basel und Schaffhausen.
·
sieben katholischen Orten : die fünf innere Orte Luzern, Zug, Uri, Schwyz
und Unterwalden, sowie Freiburg und Solothurn
·
zwei Kantonen mit beiden Konfessionen : Glarus und Appenzell
·
den zugewanderten Orten, unter ihnen Graubünden und Wallis, in denen beide
Konfessionen vertreten waren.
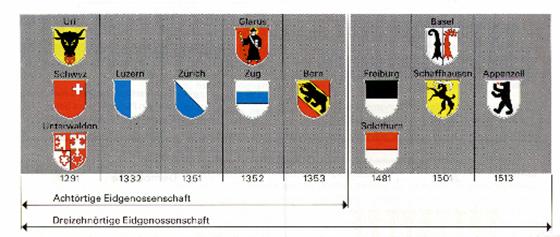
Das
Jahrhundert der Gegenreformation umfasst den Zeitraum zwischen 1560 und
1660. Drei Ereignisse haben das Wiedererstarken der katholischen Kirche
entscheidend begünstigt, und zwar :
a) die
Bündnisse :
·
der Goldene Bund
·
die Allianz der katholischen Orte mit Spanien
b) das
Konzil zu Trient (1545-1563)
c) die
Gründung des Jesuitenordens
Die
katholischen Orte wurden sich dessen bewusst, dass es vonnöten war,
gemeinsame Sache zu machen und eine einheitliche katholische Front zu
bilden, die imstande war, dem Vorstob der reformatorischen Kräfte
entgegenwirken zu können.
·
Um der Isolierung zu entgehen, schlossen die sieben katholischen Orte am
5. Oktober 1586 einen Bund, den sogenannten Goldenen Bund, später
Borromäischer Bund genannt. Die Kontrahenten versprachen sich, beim alten
Glauben zu bleiben, und verpflichteten sich, sich gegenseitig zu schützen.
·
Zur Festigung ihrer Stellung nach auben sollte die Allianz der
katholischen Orte mit Spanien, die am 12. Mai 1587 abgeschlossen wurde.
1545
rief Papst Paul 3. das Konzil nach Trient. Das Konzil verfolgte ein
dreifaches Ziel : Es ging darum, die Ketzerei auszurotten, die
Kirchendisziplin wiederherzustellen und den Frieden zu sichern.
Die
Eidgenossenschaft war der ersten Tagungsperiode (1545-1547) gleichsam
ferngeblieben. Die zweite Tagungsperiode in den Jahren 1551-1552 wurde
nach anfänglicher Zustimmung schlieblich auch boykottiert. Erst 1561
beschlossen die fünf inneren Orte, an der dritten und letzten Tagung
teilzunehmen. Freiburg und Solothurn pflichteten bald bei. Zwei Gesandte
wurden nach Trient geschickt : als Geistlicher der Abt Joachim Eichhorn
von Einsiedeln, als weltlicher Melchior Lussy. Die Beschlüsse der am 8.
Dezember 1563 beendeten Kirchenversammlung wurden in ihrer Ganzheit
angenommen.
Die
katholische Lehre wurde im Sinne des gröbten mittelalterlichen
Kirchenlehrers Thomas von Aquin neu festgelegt. Der Gegensatz zur
Lutherischen und reformierten Lehre wurde klar herausgestellt : Das Konzil
verwarf die protestantischen Dogmen und hielt an der überlieferten
Erlösungslehre fest. Die Auslegung der Bibel ist Sache der kirchlichen
Autorität, Glaube und Werke sichern das Heil der Seele.
Zur
Durchführung der katholischen Reform hat auch die Gründung des
Jesuitenordens beigetragen.
1534
rief der spanische Offizier von Loyola einen neuen, militärisch
aufgebauten Orden ins Leben, die Gesellschaft Jesu. Wie die Mönche
gelobten sie Armut, Ehelosigkeit und Gehorsam. Wie bei Soldaten war der
Gehorsam ihr oberstes Gelübde; sie wollten dem Papst ohne Zögern und
Bedenken folgen. Die Jesuiten waren als Lehrer an den Schulen und
Universitäten tätig und sorgten auf diese Weise für die katholische
Ausbildung des Nachwuchses. 1577 wurde in Luzern das erste
Jesuitenkollegium gestiftet, 1580 entstand in Freiburg das Kollegium Sankt
Michel, 1591 wurde in Pruntrut, dem Sitz des Bischofs von Basel, ein
drittes Kollegium errichtet und im 17. Jahrhundert lieben sich die
Jesuiten auch in Brig, Sitten und Solothurn nieder.
1575
wurde Jakob Christoph Blarer von Wartensee, ein energischer und
reformentschlossener Kirchenfürst, zum Bischof gewählt.
Sofort setzte er sich für die Sicherung und Stärkung der katholischen
Restgebiete seiner Diözese ein. Er erkannte die Notwendigkeit einer
engeren Verbindung mit den katholischen Orten. Am 19. November 1579 ging
Basel ein Bündnis mit den 7 katholischen Orten ein.
Dann
setzte sich der Bischof mit dem reformierten Ort Basel auseinander. An
einem Oktobertag des Jahres 1581 erschien er in Arlesheim, befiehl die
Einwohner in die Kirche und feierte hier die Messe. Die Stadt Basel
protestierte, und bald schlugen beide Parteien den Rechtsweg ein. Die
eidgenössischen Schiedsrichter aber sprachen dem Bischof das
Herrschaftsrecht über die Vogteien Zwingen, Pfeffingen und Birseck zu. So
konnten die Gebiete der Birs entlang bis hart an die Stadt Basel heran zum
groben Teil rekatholisiert werden. Es muss hinzugefügt werden, dass die
Jesuiten bei der Wiederherstellung des alten Glaubens in diesen Gemeinden
stark mitgewirkt haben.
1588
entstand in Appenzell ein Kapuzinerkloster. Es wurde der geistige
Mittelpunkt der Rekatholisierung. Die katholischen Appenzeller, die in den
inneren Rhoden in der Mehrheit waren, zwangen die bisher tolerierte
reformierte Minderheit zur Konversion oder Abwanderung. Die Antwort der
reformierten äuberen Rhoden lieb nicht lange auf sich warten. Auch sie
machten sich daran, die katholischen Minderheiten zu unterdrücken.
Von
entscheidender Tragweite war der Landteilungsbrief von 1597, der die
Teilung des Kantons in zwei konfessionelle Hälften bewirkte. Aus
politischen, konfessionellen und finanziellen Gründen verlangten die
katholischen Appenzeller die Aufnahme ins Bündnis mit Philipp 2., dem
König von Spanien. Die reformierten Appenzeller weigerten sich, in das
Bündnis einzuwilligen, und es blieb den eidgenössischen Schiedsrichtern
nichts anderes übrig, als die Trennung Appenzells in die beiden
selbständigen Staaten Appenzell-Auberrhoden und Appenzell-Innerrhoden zu
beschlieben.
Seit
1531 hatte sich der neue Glaube im Lande Glarus immer mehr ausgebreitet
und die fünf inneren Orte waren bemüht, dieser Entwicklung ein Ende zu
setzen. Aegidius Tschudi, Inhaber des Landammanamtes, wollte das Land
gewaltsam rekatholisieren und die Neugläubigen austreiben. Aber der in die
Schweiz beordete Nuntius Giovanni Antonio Volpe wollte keinen Krieg und
trat für eine Entspannung in der Eidgenossenschaft ein. Der Streit um den
sogenannten Glarnerhandel wurde zunächst im Jahre 1564 durch einen Vertag
friedlich geschlichtet. Dieser Vertrag war eine Kompromisslösung, insofern
als er das Simultaneum einführte. Aber es stellte sich heraus, dass der
Vertrag keine langfristige Lösung bot. Der katholische Glaube verlor immer
mehr an Boden : um 1600 kamen auf zwei Katholiken sieben Protestanten.
Nach jahrzehntelangen Streitigkeiten wurde im Jahre 1623 ein neuer
Landesvertrag abgeschlossen, dessen Ergebnis eine zwar nicht territoriale
Scheidung des Landes wie in Appenzell, wohl aber eine funktionelle. Dieser
Landesvertrag bringt konfessionell getrennte Landsgemeinden. Zu den
Tagsatzungen bestimmte jede Glaubenspartei ihren Vertreter.
Wenn
man vom Grauen Bund absieht, war in Graubünden die Reformation zum groben
Teil durchdrungen. Zwei Parteien standen sich gegenüber, die durch zwei
Familien vertreten waren :
·
die protestantisch gesinnten Salis
·
die Planta, die dem alten Glauben treu geblieben waren.
Im
Februar 1751 wurde Dr. Johann von Planta damit beauftragt, die der
katholischen Kirche entfremdeten kirchlichen Güter in den Bistümer Chur
und Como zurückzuerlangen, was zu Unruhen in der reformierten Bevölkerung
führte. Die Salis leiteten die Volksbewegung, von Planta wurde verhaftet
und am 31. März 1572 hingerichtet.
Die
Konflikte
zwischen der katholischen und der protestantischen Partei setzten sich bis
zum Ende des dreibigjährigen Krieges fort. Dieser Konflikt äußerte
sich in einer Reihe von kriegerischen Episoden :
